Die Sklaventransporter | Der Transatlantische Dreieckshandel
Fundstück aus dem Archiv
armin fischer/mare
Bis weit ins 19. Jahrhundert verschifften europäische Sklavenhändler viele Millionen Schwarze in die Karibik. Dahinter stand Europas Gier nach Zucker
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verzeichnete eine Londoner Firma, die medizinische Gerätschaften vertrieb, eine ungewöhnlich gesteigerte Nachfrage nach einem Instrument mit Namen ›speculum oris‹ (Mundspiegel). Der metallene Spreizer diente Ärzten dazu, bei einem Kinnladenkrampf den Mund des Patienten gewaltsam zu öffnen – eine Brachialtherapie, die nur selten angewendet wurde. Als der Chef des seriösen Londones Handelshauses der Sache auf den Grund ging, stieß er auf einen schmuddeligen Liverpooler Laden, in dessen Schaufenster neben Daumenschrauben, Hand- und Fußfesseln auch der Kinnspreizer lag – sämtlich Ausrüstungsgegenstände für Sklavenschiffe: Gefangenen Schwarzen, die lieber Hungers sterben wollten, als geknechtet und deportiert zu werden, wurde mit dem ›spekulum oris‹ brutal der Mund aufgehebelt, um ihnen Nahrung einzuflößen.
Zu dieser Zeit hatte sich der Handel mit verschleppten afrikanischen Arbeitskräften längst zu einer regelrechten Industrie entwickelt – dementsprechend großen Bedarf an Folter- und Knebelwerkzeugen hatten die Schergen der Sklavenhändler.
Der Handel mit verschleppten Schwarzen war eine Industrie
250 Jahre vorher hatte die massenhafte Menschenschinderei auf seltsame Art begonnen, nämlich damit, daß ein Mensch andere von ihrer Arbeitsfron erlösen wollte: Im Jahr 1514 wurde dem Padre Bartolomé de Las Casas ein Stück Land in der spanischen Kolonie Kuba übereignet. Zu dem Land gehörten rund 100 eingeborene Kariben, die wie Sklaven gehalten wurden und auf den Plantagen arbeiten mußten. Als Las Casas erkannte, wie sehr die Indios bei ihrer aufgezwungenen Arbeit litten und als er sah, wie viele dabei an Krankheiten und Selbstmord starben, schlug er seinem König Karl V. vor, Negersklaven, die als fügsame und willige Arbeiter galten, für die Arbeit in den Kolonien einzuführen. – Dies war der Startschuß für den Transatlantischen Sklavenhandel.
Las Casas, dem es zunächst nur um die Gleichberechtigung der Karibik-Indianer gegangen war, ahnte (noch) nicht, welche Lawine er losgetreten hatte. Später, als er sah, was er angerichtet hatte, ging er zurück nach Spanien und startete eine landesweite Kampagne gegen den Sklavenhandel – ohne Erfolg. Die Sklaverei hatte ein neues Territorium gefunden und sollte es so schnell nicht wieder aufgeben.
Ein Leben ohne Sklaven war bald nicht mehr vorstellbar
Die Kolonialherren in Südamerika und auf den Karibischen Inseln erkannten bald, wie sehr ihnen die schwarzen Sklaven bei der harten Arbeit unter der unbarmherigen Tropensonne nützen konnten, zumal die meisten von ihnen, die von der afrikanischen Westküste (vor allem aus Sierre Leone, von der Goldküste, aus Benin, Angola und Ghana) stammten, dank ihrer angeborenen Sichelzellenanämie gegen die überall grassierende Malaria resistent waren. Bald konnten sich die Eroberer aus der Alten Welt ein Leben ohne Sklaven nicht mehr vorstellen. Schließlich waren sie nicht in die Ferne gezogen, um sich abzurackern, nein, sie wollten schnell reich werden, ein bequemes Leben führen und andere für sich arbeiten lassen.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als sich der Zuckerrohranbau auf den Inseln auszuweiten begann, wurde die Nachfrage nach Sklaven immer drängender. Statt Haussklaven, Mätressen, Laufburschen und Gärtner war jetzt eine andere Art von ›Ware‹ gefragt: der reine Arbeitssklave für die zermürbende Schinderei auf den Zuckerrohrfeldern. So beförderte vor allem die (europäische) Nachfrage nach Zucker, der damals ein mit Gold aufzuwiegendes Luxusgut war, die Verschleppung von Millionen Schwarzen.
Es war ein gewaltiger historischer Rückschritt
Historisch gesehen bedeutete dieser Akt der Massenvergewaltigung einen Rückschritt in der Zeit um 1000 Jahre. Denn in Europa war die Sklaverei seit langem durch das System der Leibeigenschaft ersetzt. Die Leibeigenen, die zwar auch ihren Herren ›untertan‹ waren, hatten jedoch Freiheiten, die für Sklaven undenkbar waren: Qie konnten ein eigenes Stück Land bewirtschaften, heiraten, ein ›Privatleben‹ führen – alles natürlich in Abhängigkeit von der Großzügigkeit und Gunst des Lehnsherren. Sklaven dagegen waren einfach ein ›Besitz‹, wie ein paar schöne Stiefel oder ein Ochse. Sie konnten verschenkt, verkauft, vergewaltigt, erschlagen werden – niemand scherte sich darum. Man muß bis zur Zeit der römischen Latifundien zurückgehen, um eine ähnliche Form der Massensklaverei zu finden, wie sie ab dem 16. Jahrhundert von den ›modernen‹ europäischen Nationen wieder betrieben wurde. Und die Zahl der karibischen Zucker- und der späteren amerikanischen Baumwollsklaven übertraf seit der Antike zum ersten Mal wieder jene zwei Millionen Arbeitssklaven, die das Römische Reich 100 v. Chr. zählte. Die transatlantische Sklaverei wurde zur »monströsesten Verirrung in der Geschichte des Abendlandes« (H. Hobhouse). Die Zahl der Afrikaner, die im Laufe der Jahrhunderte übers Meer verschleppt wurden, ist schwer zu schätzen, sie liegt bei etwa 20 Millionen, nur etwa 15 Millionen erreichten lebend das Ziel.
Ende des 16. Jahrhunderts stieg die Nachfrage nach Zucker immer weiter
Im Jahre 1510 gab es erst eine Handvoll Zuckerrohr-Plantagen auf den karibischen Inseln. 50 Jahre später waren es Hunderte und der Zuckerexport nach Europa setzte ein. Weitere 50 Jahre später war die Karibik der Hauptproduzent und Exporteur für europäischen Zucker. Und nachdem dieTürken die traditionellen Anbauländer Zypern, Kreta und die nordafrikanischen Küstenländer besetzt und den größten Teil des mediterranen Zuckergewerbes zerstört hatten, war für die Handelszentren der Alten Welt karibischer Zucker nicht nur willkommen, nein, er war plötzlich notwendig geworden. So stieg, Ende des 16. Jahrhunderts, die Nachfrage kontinuierlich und die Produzenten konnten ihr kaum noch gerecht werden.
Kaum eine Pflanze wurde damals so arbeitsintensiv gewonnen, wie das Zuckerrohr. Das Pflanzen war monotone Handarbeit, das Ernten muskelzehrende Schinderei. Beim Auskochen der Pflanzen im ›Zuckerhaus‹ entstanden Temperaturen von 60 Grad, denen die Arbeiter stundenlang ohne Pause ausgesetzt waren. Die Plantagenbesitzer litten permanent unter Arbeitskräftemangel. Ständig mußte Nachschub an neuen Sklaven her.
Skrupellose Geschäftemacher erkannten früh, daß in diesen Zeiten mit dem Handel von schwarzen Arbeitskräften noch viel mehr Geld zu verdienen war, als wenn man die Sklaven für sich arbeiten ließ. Ursprünglich waren die Negersklaven vom Europäischen Umschlagplatz Lissabon in die neue Welt verschifft worden. (Obwohl die meisten Europäer damals nicht mehr als eine schimärenhafte Vorstellung vom Kontinent Afrika hatten, gab es hier bereits einen florierenden Neger-Sklavenmarkt – bedient von Freibeutern und arabischen Händlern.) Doch das reichte jetzt nicht mehr. Um 1530 schickte man erstmals Sklaven direkt von Afrika aus in die Karibik – der beginnende Dreieckshandel zwischen Europa, der afrikanischen Westküste und den karibischen Inseln gab der Sklaverei eine neue Dimension.
Um das Jahr 1530 begann der Dreieckshandel
Dieses Geschäft lief folgendermaßen ab: vorwiegend englische, spanische und französische Schiffe brachten minderwertige Waren nach Westafrika, oft grobes Tuch, Eisenwaren und Alkohol, manchmal Feuerwaffen, Schießpulver und Munition, die sie bei einheimischen Sklavenhändlern gegen ›lebendige Ware‹ eintauschten. Oft wurden einheimische Häuptlinge dazu angestachelt, Krieg gegen andere Stämme zu führen, nur um Gefangene zu machen, die dann versklavt wurden. Wenn das Schiff schließlich mit in Ketten gelegten Sklaven vollgepfercht war – manchmal 600 und mehr, stach es zur Atlantiküberquerung in See. Nach sechs bis acht Wochen waren die karibischen Häfen erreicht und die Sklaven wurden nach und nach verkauft. Hauptumschlagplätze waren Port Royal und Kingston auf Jamaika. Wenn die lebende Fracht von Bord war, faßten die Schiffe Rum, Melasse und groben, einmal raffinierten Zucker und traten, begünstigt von den vorherrschenden westlichen Winden, die Heimreise an.
Die Händler machten enorme Gewinne. In den frühen Tages des Dreieckshandels war ein männlicher Sklave an der afrikanischen Goldküste für 2 bis 3 Pfund zu kaufen – das entspricht dem Preis einer nicht mehr ganz neuen Muskete. Der Verkaufspreis in der Karibik lag bei rund 25 Pfund, manchmal auch wesentlich höher – je nach Nachfrage. Eine Gewinnspanne von 700 Prozent markierte eher die untere Grenze. Hier die Kostenrechnung des Sklavenschiffes ›La Fortuna‹ aus Havanna, 1827 (Aus: Christopher Lloyd, The Navy and the Slave Trade):
Fahrtkosten (Alle Beträge in Dollar)
- Kosten eines Neunzig-Tonnen-Schoners 3700
- Fracht, 200 000 Zigaretten und 500 Dublonen 10900
- Abfertigung und Schweigegeld 200
- Gesamtkosten inklusive Löhne etc. 20747
Kosten nach der Rückkehr
- Provision des Kapitäns für 217 Sklaven 5565
Erlös
- Verkauf des Schiffes 3959
- Verkauf von 217 Sklaven 77469
- Gesamterlös 81419
- Gesamtkosten 39980
- Nettogewinn 41439
Die Verhältnisse unter denen die Sklaven an Bord der Schiffe untergebracht und transportiert wurden, waren schauderhaft: Auf manchmal fünf, teils provisorisch eingezogenen Zwischendecks, lagen sie auf den nackten Holzplanken. Die Decks waren so eng übereinandergebaut, oft nur in meterabstand, daß aufrechtes Stehen unmöglich war. Für Männer, Frauen, Burschen und Mädchen gab es getrennte Abteilungen. Die Männer waren mit eisernen Fußfesseln jeweils zu zweien aneinander gekettet. Damit die wie Tiere Eingepferchten wenigstens ihre Notdurft verrichten konnten, standen auf den Decks einige Holz- oder Blecheimer, die je nach Laune und Sorgfalt der Mannschaft mehr oder weniger regelmäßig geleert wurden. Die ›Reise‹ dauerte für die Sklaven – inclusive Liegezeiten in Häfen – bis zu drei Monaten. Bei schönem Wetter brachte man sie an Deck, wo sie zu Trommel- (oder Peitschen-) schlägen zum Tanzen gezwungen wurden – denn sie sollten ja bewegungsfähig bleiben. Viele nutzten diese Gelegenheit, um über Bord zu springen, da sie den Tod im Meer dem nicht endenwollenden Leiden im Bauch des Schiffes vorzogen.
Bei der Überfahrt starben rund 30 Prozent der Sklaven
Einige Zahlen sagen mehr als viele Schilderungen: Nach offiziellen (englischen) Berechnung durfte das Sklavenschiff ›Brookes‹ bei einer Länge von 30 und Breite von 7,5 Metern maximal 482 Sklaven an Bord nehmen (tatsächlich waren es jedoch meist an die 600). Der dabei für einen männlichen Sklaven bemessene Platz betrug 1,80 x 0,40m, für eine Frau 1,50 x 0,40m. Für einen Burschen wurden 1,50 x 0,35m berechnet, für ein Mädchen 1,35 x 0,30m. Daß unter diesen Bedingungen auf der Überfahrt oft dreißig Prozent der Sklaven an Fieber, Ruhr, Unterernährung und aus vielen anderen Gründen starben, war nichts Ungewöhnliches. – Da jedoch für die Händler jeder verlorene Sklave wirtschaftlichen Schaden bedeutete, setzten sich im Laufe der Jahre jene Kapitäne durch, die Sklaven (und Mannschaft) besser behandelten und dadurch die Sterblichkeitsrate senkten.
Der Dreieckshandel war im Wesentlichen ein Geschäft der großen europäischen Seefahrernationen, aber auch die Deutschen waren am Menschenhandel beteiligt: Auf Geheiß des Brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. ging ein Trupp Soldaten am 1. Januar 1683 beim Kap Tres Puntos im heutigen Ghana an Land und errichtete ein Handelsfort. Das Fort war nichts anderes als ein Zwinger, in dem die an der Küste von lokalen Händlern aufgekauften Sklaven bis zu ihrem Abtransport nach Übersee eingesperrt wurden. Auf die rechte Schulter wurden ihnen die vier Buchstaben ›CABC‹ eingebrannt (Churfürstliche Afrikanisch-Brandenburgische Companie). Insgesamt waren die Brandenburger direkt verantwortlich für den Verkauf von ca. 30.000 Afrikanern nach Amerika. Doch weil die Gewinne nicht erwartungsgemäß hoch ausfielen, währte das deutsche Interesse nicht lange. Schon 1721 verkaufte der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. das Handelsfort ›Großfriedrichsburg‹ an die Holländer.
Als im Europa des 17. Jahrhunderts die Getränke Kaffee, Tee und Kakao populär wurden, gab dies der Zuckerindustrie einen enormen Schub, denn ohne Zucker, so meinte man, wären alle drei kaum genießbar. Die Zuwachsraten der Zuckerproduktion stiegen nun exponentiell, die europäischen Gaumen wollten verwöhnt werden. Auf Jamaika begannen sich riesige Monokulturen zu entwickeln, im Jahre 1783 gab es beispielsweise 100 Plantagen. Auf jeder davon arbeiteten rund 500 Sklaven.
Fast aller Zucker, der in Europa konsumiert wurde, stammte aus Sklavenarbeit
Um das Jahr 1800 wurde so gut wie jedes Gramm Zucker, das in England konsumiert wurde, von Sklaven angebaut und produziert. Die englische Bevölkerung zählte zu dieser Zeit rund 9 Millionen und der Zuckerverbrauch lag bei mindestens 17 Pfund pro Kopf und Jahr; dies entspricht einem Gesamtverbrauch von über 70 000 Tonnen. »Da in jenem Jahr der Gegenwert eines Schwarzen bereits zwei Tonnen (Zucker, d.A.) betrug, entsprach dieser Gesamtverbrauch über 35 000 schwarzen Sklaven, die auf den Inseln verschlissen wurden. Oder anders: Für jeweils 250 Engländer … mußte jedes Jahr ein Schwarzer sein Leben lassen.« (H. Hobhouse) – Bei den anderen Zucker-importierenden Nationen verhielt es sich natürlich nicht viel anders.
Im Jahre 1789 stand die Französische Revolution unter dem Motto »Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit« , 1783 erstritten sich die Amerikaner die Unabhängigkeit von England. Die amerikanische Verfassung, die in vielen Belangen fortschrittlichste ihrer Zeit, garantierte jedem Bürger das Recht auf ›persönliches Glück‹. In vielen Staaten Europas gab es nun Emanzipationsbestrebungen gegen Staat und Obrigkeit, und die Stimmen mehrten sich, daß so etwas wie die Sklaverei mit dem modernen Denken nicht mehr zu vereinbaren sei.
Tendenzen zur Abschaffung des Sklavensystems
Dennoch dauerte es Jahrzehnte, bis das, was in europäischen Parlamenten in hehren Reden vorgetragen wurde, in den fernen Kolonien zum Tragen kam. England beispielsweise beseitigte die Sklaverei offiziell am 1, August 1834 mit einer fünfjährigen ›Lehrzeit‹ für die ehemaligen Sklaven, die danach freie und unabhängige Bürger waren. Auch Frankreich brauchte bis zum Jahr 1830, um sich zu einer Abschaffung des Sklavensystems durchzuringen. Der letzte legale Sklaventransport nach Brasilien fand 1854 statt; und erst 1870 wurden die Sklaven in den spanischen Kolonien frei. Die Vereinigten Staaten hatten US-Bürgern schon 1800 den Sklavenhandel verboten; und doch sollten es – gerade, als die karibischen und südamerikanischen Sklavensysteme sich aufzulösen begannen – ausgerechnet die Amerikaner, jene Vorreiter der Demokratie sein, die einen neuen Nährboden für die letzte Sklavenhaltergesellschaft der Neuzeit bereiteten: die Baumwollfelder der amerikanischen Südstaaten.
Um 1750 war die Herstellung von Baumwoll-Tuch aufwendiger und damit teurer als die von Seide. Die in England einsetzende industrielle Revolution veränderte dann in starkem Maße die Textilindustrie. Durch maschinelle Verarbeitung des Garns wurde fertiger Baumwoll-Stoff wesentlich billiger. Was fehlte, war die Rohbaumwolle. Wie schon der Zucker, kam auch sie aus der Neuen Welt, diesmal aus den Südstaaten der USA, genauer: aus North und South Carolina, Georgia, Alabama, Lousiana und Mississippi.
Nach dem Zucker kam die Baumwolle
Anfang des 19. Jahrhunderts explodierten die Baumwollexporte aus den USA nach Europa: 1830 waren es 100 Millionen Pfund, 1840 schon 800 Millionen und 1850 mehr als 2 Milliarden Pfund. Gleichzeitig verachtfachte sich zwischen 1784 und 1861 die Zahl der schwarzen Sklaven in Nordamerika – auf am Ende über 4 Millionen. Um die Nachfrage zu decken, mußten die Baumwollfelder ständig vergrößert werden. Pro hundert Morgen neues Baumwoll-Land brauchte man dabei 10 bis 20 neue Sklaven. Doch der Nachschub wurde zum Problem. Die USA selbst hatten den Sklavenhandel mit Drittstaaten 1800 und den innerstaatlichen Handel 1807 verboten. Die Hafenstädte Savannah in Georgia und Charleston in South Carolina entwickelten sich zum Umschlagplatz für illegal aus Südamerika und der Karibik eingeschmuggelte Sklaven. Doch das reichte nicht, und so entstand, vor allem in den Staaten Virginia, North und South Carolina und Maryland ein letztes, perverses Geschäft mit der Ware Mensch: Die ›Sklavenzucht‹; wenn man dafür sorgte, so die Kalkulation der Händler, daß jeder Sklavin einer Plantage ständig genügend »für die Zucht geeignete Zeuger« zur Verfügung standen, konnten 25 bis 40 Prozent der Frauen ein Baby pro Jahr ›produzieren‹. – Ließ man die Sklaven dagegen heiraten und monogam leben, war nur bei 10 bis 15 Prozent mit Nachwuchs zu rechnen…
Dieses System mit seinen menschenverachtenden Auswüchsen war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einfach nicht mehr haltbar, zum einen aus moralischen Gründen, zum anderen aber auch aus ökonomischen: denn längst wurde von den Investoren des Baumwoll-Geschäfts bezweifelt, daß die Sklavenwirtschaft wirklich effizienter war als Lohnarbeit.
Die ›Besitzer‹ wollten ›ihre‹ Sklaven nicht so ohne weiteres freigeben
Doch Sklaven stellten für ihre Besitzer materielle Werte dar, auf die sie nicht entschädigungslos verzichten wollten: Der geschätzte ›Wert‹ aller Sklaven Nordamerikas betrug 1850 mehr als 2 Milliarden Golddollar, das entsprach damals etwa dem zehnfachen Staatshaushalt der USA. Das Problem war nicht per Federstrich vom Tisch zu bringen. Die amerikanischen Nordstaaten plädierten seit vielen Jahrzehnten für die endgültige Abschaffung der Sklaverei, der halsstarrige, baumwollproduzierende Süden aber, wollte um jeden Preis daran festhalten. Die Sklavenfrage war einer der Hauptgründe für den amerikanischen Bürgerkrieg, der 1861 begann. Nach vierjährigem Gemetzel dominierte der in allen Belangen überlegene Norden.
Dies war das Ende der letzten großen Sklavenhalter-Gesellschaft. – Der Baumwollanbau jedoch ging nach dem Krieg weiter, mit Rekordernten – produziert von freien Arbeitern.
Armin Fischer, mare, Ausgabe 1 Transatlantik, April 1997
Der Artikel ist erschienen in der ersten Ausgabe der Zeitschrift mare, Titelthema Transatlantik.
Bitte beachten Sie: Die Artikel auf dieser Webseite sind das geistige Eigentum von Armin Fischer und dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis reproduziert, kopiert, bearbeitet, veröffentlicht oder auf anderen Webseiten wiedergegeben werden. Ausgenommen hiervon sind Snippets/Verlinkungen im üblichen Rahmen (wie es etwa auch google macht), sowie normale Zitate.
Insbesondere für obenstehenden Artikel: Falls Sie Material für eine wissenschaftliche Arbeit oder Ähnliches benötigen, wenden Sie sich bitte an den Autor.
–> (t&t)

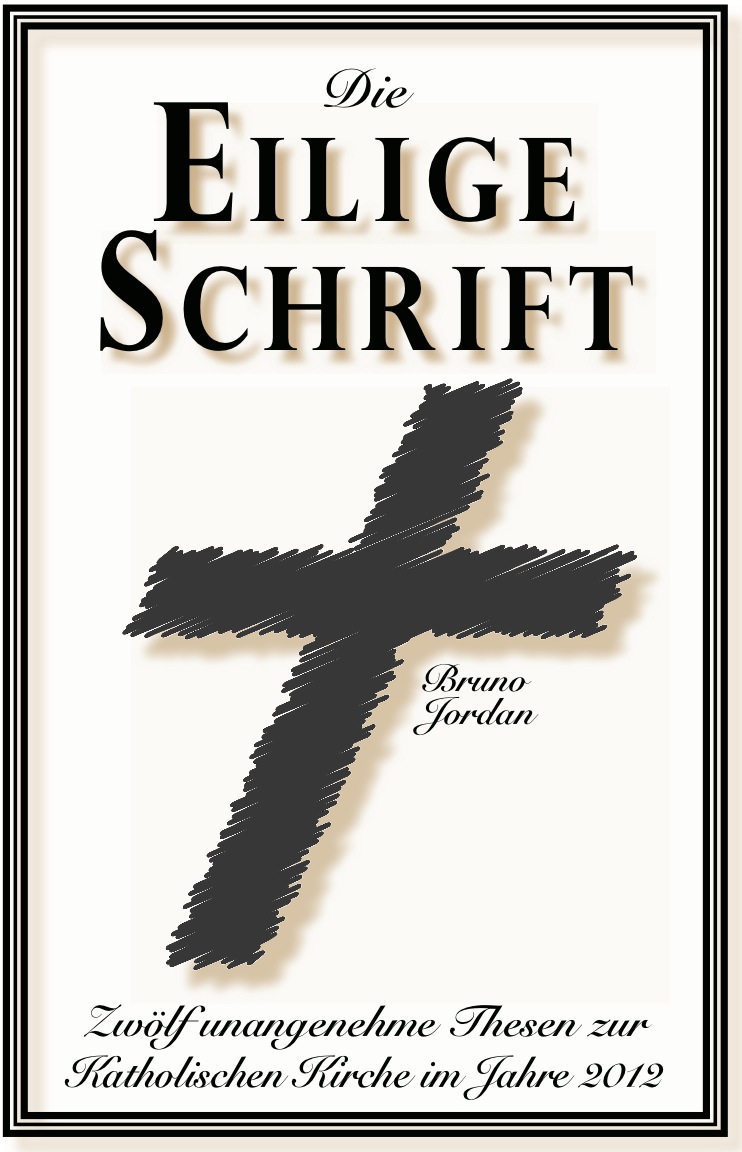
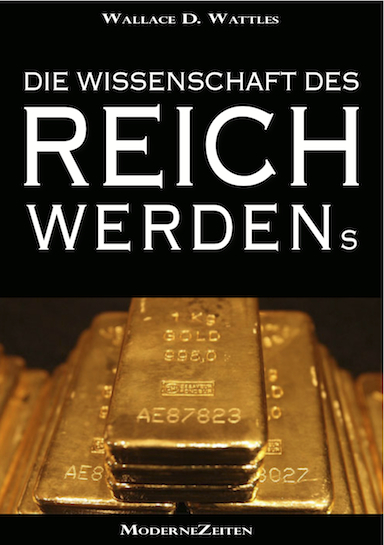
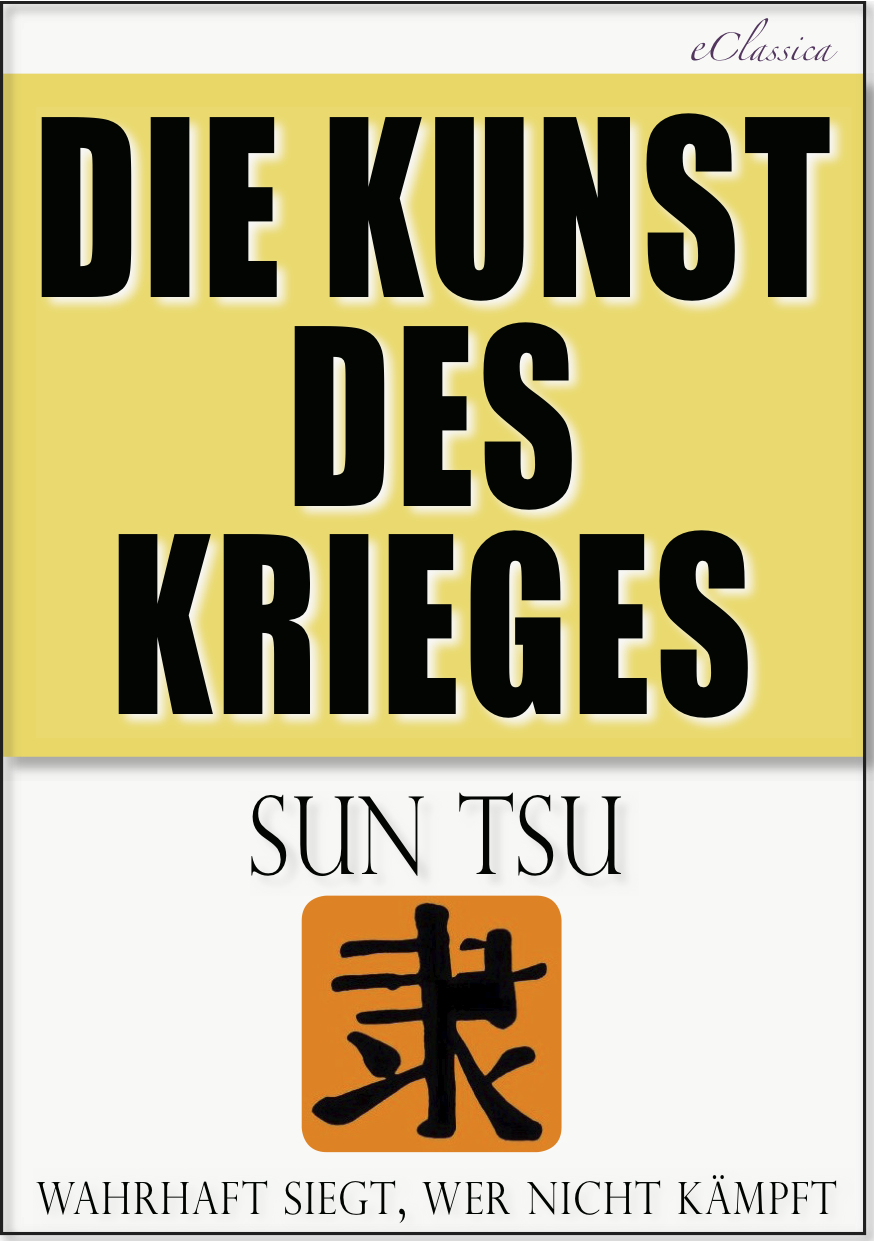

Herzlichen Dank für den hilfreichen Post! Prima Blog.
Kommentar 1